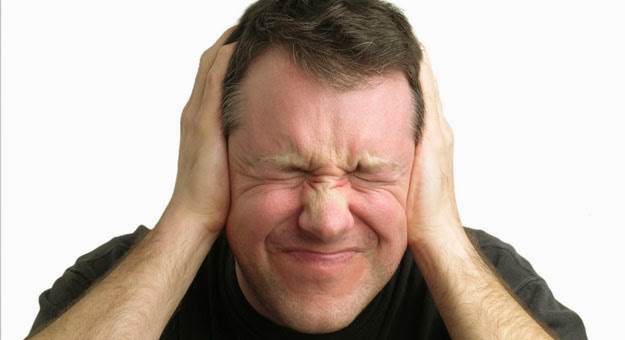
Amsterdam-Saba:
Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass die Abneigung gegen Geräusche, unter der manche Menschen leiden, mit genetischen Faktoren wie Angstzuständen und Depressionen zusammenhängt und dass die Betroffenen mit höherer Wahrscheinlichkeit über Gene verfügen, die mit psychischen Störungen und Tinnitus in Verbindung stehen.
Während es den meisten Menschen unangenehm ist, wenn jemand mit den Fingernägeln über eine Kreidetafel kratzt, können Menschen mit Phonophobie ebenso stark auf Geräusche wie Nippen, Schnarchen, Atmen und Kauen reagieren, heißt es in der Studie, die in der Fachzeitschrift Frontiers in Neuroscience veröffentlicht wurde.
Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 deutet darauf hin, dass Wählerhass weiter verbreitet ist als bisher angenommen. Europäische Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Krankheit genetische Gemeinsamkeiten mit Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen aufweist.
Der Psychiater Dirk Smit von der Universität Amsterdam und seine Kollegen analysierten genetische Daten des Psychiatric Genomics Consortium, der UK Biobank und der 23andMe-Datenbanken und fanden heraus, dass Menschen, die sich selbst als an Phonophobie leidend bezeichneten, mit höherer Wahrscheinlichkeit Gene besaßen, die mit psychiatrischen Störungen sowie Tinnitus in Verbindung stehen.
Patienten mit Tinnitus – einem anhaltenden, starken Klingeln in den Ohren – weisen außerdem häufiger psychische Symptome wie Depressionen und Angstzustände auf.
„Es gab auch Überschneidungen mit PTBS-Genen“, sagte Smith zu Eric W. Dolan von PsyPost. „Das bedeutet, dass Gene, die eine Anfälligkeit für PTBS verleihen, auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine Phonophobie zu entwickeln. Das könnte auf ein gemeinsames neurobiologisches System hindeuten, das beide beeinflusst. Das könnte darauf hindeuten, dass Behandlungstechniken, die bei PTBS angewendet werden, auch zur Behandlung von Phonophobie eingesetzt werden könnten.“
Dies bedeutet nicht unbedingt, dass Phonophobie und andere Krankheiten gemeinsame Mechanismen haben, sondern nur, dass einige der genetischen Risikofaktoren ähnlich sein könnten.
Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen mit einer Abneigung gegen Geräusche eher dazu neigen, ihre Belastung zu internalisieren. Dies wird auch durch die 2023 veröffentlichte Studie von Smith und seinem Team untermauert, die starke Zusammenhänge mit Persönlichkeitsmerkmalen wie Angst, Schuld, Einsamkeit und Neurotizismus aufzeigt.
„Die Reaktionen auf ein auslösendes Geräusch können von Ärger und Wut bis zu einer Belastung reichen, die das tägliche Leben beeinträchtigt … Es wird vermutet, dass die Geräuschaversion eher auf Schuldgefühlen wegen der ausgelösten Belästigung und Wut beruht als auf Verhaltensausdrücken der Wut selbst, die die Belastung verursacht“, schrieben Smith und sein Team.
Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) leiden seltener an Phonophobie. Dies war unerwartet, da Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen eine geringere Fähigkeit haben, Geräusche zu ertragen.
„Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Phonophobie und Autismusspektrumstörungen in Bezug auf genetische Variation relativ unabhängige Störungen sind“, schrieben die Forscher in ihrem Artikel. „Dies legt die Möglichkeit nahe, dass es andere Formen der Phonophobie gibt, die Art, die oft dadurch entsteht, dass Wut oder andere negative Emotionen auf bestimmte Geräusche konditioniert werden, die durch Persönlichkeitsmerkmale modifiziert werden.“
Smith und seine Kollegen weisen darauf hin, dass ihre Daten überwiegend auf europäischen Populationen beruhen und daher in unterschiedlichen Populationen möglicherweise nicht dieselben Zusammenhänge auftreten. Darüber hinaus wurde die Audiophobie in den von ihnen erhaltenen Datenproben nicht medizinisch diagnostiziert, sondern lediglich selbst angegeben, was die Ergebnisse ebenfalls verfälschen kann.
Ihre Studie liefert jedoch auch Hinweise darauf, worauf sich weitere Forschungen konzentrieren könnten, um den biologischen Mechanismus der Stimmaversion zu ergründen.